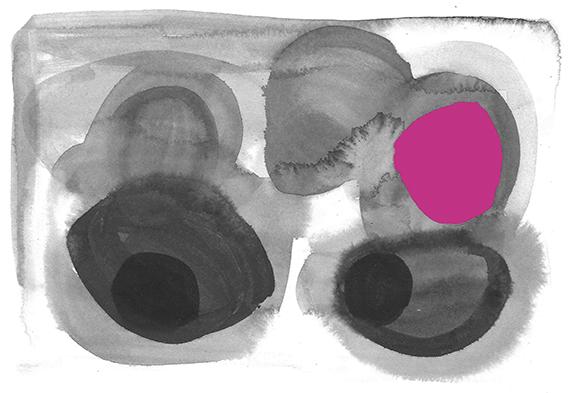Sosf: Die Eurodac-Datenbank wird im Zuge der GEAS-Reform zu einem umfassenden Asyl-Informationssystem ausgebaut. Welchen Zwecken soll sie in Zukunft dienen?
Hanna Stoll: Aktuell speichert Eurodac zehn Fingerabdrücke und das Geschlecht von Personen, die einen Asylantrag stellen oder beim undokumentierten Überschreiten der EU-Aussengrenzen aufgegriffen wurden. So kann festgestellt werden, ob sie schon in einem anderen Land registriert wurden und dieses Land allenfalls für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Dieser eng umrissene Zweck wird in der neuen Eurodac-Verordnung stark ausgeweitet.
Neu dient Eurodac explizit auch der Kontrolle und Bekämpfung der irregulären Migration, insbesondere der sogenannten Sekundär-Migration, der Identifizierung zwecks Rückführung und der Strafverfolgung. Durch diese Ausweitung der gesetzlichen Zwecke entstehen neue Nutzungsmöglichkeiten, die bisher nicht erlaubt waren.
Welche Daten werden dazu neu erfasst?
Neben den Fingerabdrücken und dem Geschlecht speichert Eurodac biometrische Gesichtsbilder und erstmals auch persönliche Angaben: Vor- und Nachnamen, Aliasnamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeiten, die Art, die Nummer und das Ablaufdatum der Identitäts- und Reisedokumente, Angaben zu ihrer Echtheit sowie eingescannte Farbkopien dieser Dokumente. Auch werden der erfassende und der gemäss Dublin zuständige Mitgliedstaat eingetragen, allfällige Überstellungen, Ausreisen oder Ausschaffungen und ob ein Asylantrag rechtskräftig abgelehnt oder als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen wurde. Ausserdem wird in einem vorgelagerten Verfahren eine grobe Prüfung vorgenommen, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Ist dies der Fall, muss festgestellt werden, ob die Person gewalttätig oder bewaffnet ist, oder ob Hinweise darauf bestehen, dass sie an einer Straftat beteiligt ist. Wenn ja, wird auch das in Eurodac festgehalten. Das alles ab einem Alter von sechs Jahren und nicht nur von Personen, die einen Asylantrag stellen, sondern auch von im Inland aufgegriffenen Sans-Papiers, von Personen mit vorübergehendem Schutz, von Resettlement-Flüchtlingen und von aus Seenot Geretteten.
Was wird mit all diesen Daten gemacht?
Oft wird argumentiert, dass Geflüchtete dadurch leichter zu identifizieren sind und Rückführungen vereinfacht werden. Ich wage aber zu bezweifeln, dass ein Grossteil der Ausschaffungen heute tatsächlich an mangelnder Identifizierung scheitert.
Klar ist, dass die EU und die Mitgliedstaaten dadurch ein umfassendes Wissen über die Flucht- und Migrationsbewegungen innerhalb Europas generieren wollen. Eu-LISA, die EU-Agentur, die Eurodac betreibt, wird in Zukunft beispielsweise monatlich anhand von mehr als 80 Kriterien statistische Auswertungen der Eurodac-Daten vornehmen, die natürlich der stärkeren Kontrolle und Überwachung dienen.
Eurodac wird in Zukunft auch kein isoliertes System mehr sein, sondern im Zuge der sogenannten Interoperabilität mit weiteren Datenbanken der EU verknüpft. Die Daten werden also auch über Eurodac hinaus und nicht mehr nur zu migrations- oder asylpolitischen Zwecken verwendet, sondern auch zu Polizei- und Sicherheitszwecken.
Welche Probleme entstehen dadurch?
Die Grenzen zwischen Verwaltungs- und Strafrecht verschwimmen immer mehr. Wenn es bei der Sicherheitsüberprüfung zum Beispiel einen Datenbank-Treffer gibt, der auf eine Gefährdung der inneren Sicherheit hindeutet, und eine Person als «gewalttätig» oder «bewaffnet» eingestuft wird, kann das in Eurodac eingetragen werden und dazu führen, dass das Asylverfahren vorerst ausgesetzt wird. Eigentlich sollte ein solcher Fall ja einfach zur Anzeige gebracht werden. Wenn der Person aufgrund dieses Eintrags aber wichtige Verfahrensrechte und potenziell auch materielle Rechte wie der Zugang zu Asyl entzogen werden, ist das rechtlich problematisch.
Zur Ermittlung und Verhinderung von Straftaten erhalten in der Schweiz neu auch das fedpol, der Nachrichtendienst des Bundes sowie die Kantons- und Stadtpolizeien Zugang zu Eurodac. Dem liegt eine Ungleichbehandlung von Asylsuchenden zugrunde. Denn eigentlich haben diese Behörden keinen Zugriff auf biometrische Daten von nicht vorbestraften Personen – zumindest bislang nicht europaweit. Die einzige Rechtfertigung dafür, dass sie diesen nun bekommen, ist die Herkunft der erfassten Personen – und das ist diskriminierend. Auch wird sich diese Diskriminierung noch verstärken, weil Asylsuchenden durch die umfassendere Datengrundlage mehr Straftaten zugeordnet werden können. Es wird also so aussehen, als seien sie tatsächlich häufiger straffällig. Dabei ist es nur die Aufklärungsrate, die höher ist.
Was werden die Folgen für Geflüchtete sein?
Wenn so sensible Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder im grossen Stil erfasst und zugänglich gemacht werden, dann muss besonders viel Wert auf die Verhältnismässigkeit gelegt werden. Diese wird bei Eurodac aber gar nicht mehr hinterfragt.
Wenn diese Daten dann noch in ein komplexes und interoperables Daten-Netzwerk eingespeist werden, müssten die Datenschutzstandards eigentlich umso höher sein. Die «Datensubjekte» müssten darüber informiert werden und verstehen können, was mit ihren Daten geschieht, wofür sie erhoben und wofür sie genutzt werden. Wenn das nicht passiert, können sie auch ihre Rechte nicht geltend machen, beispielsweise bezüglich Einsicht und Berichtigung. Fehler bei der Datenerhebung kommen erstaunlich häufig vor, und sie multiplizieren sich gerade in interoperablen Systemen – mit unabsehbaren Folgen.
Du hast dich kürzlich an der Vernehmlassung zur Eurodac-Reform beteiligt. Was bemängelst du konkret an der geplanten Schweizer Umsetzung?
Es gibt verschiedene Aspekte, die in der Umsetzung verbessert oder präzisiert werden müssten. Als Beispiel: Schon heute wird Eurodac gemäss verschiedener Studien von Asylsuchenden kaum verstanden. Die Schweiz hat das Informationsrecht bisher stiefmütterlich behandelt und die vom Bundesrat vorgeschlagene Umsetzung sieht bislang keine Stärkung dieses Rechts vor.
Was schlägst du stattdessen vor?
Erstens müsste es bereits während der Datenerfassung im Rahmen des Screenings eine unentgeltliche Rechtsvertretung geben, die auch zuständig ist, wenn es um die Berichtigung von Daten oder um die Ergebnisse und Folgen der Sicherheitsüberprüfung geht.
Zweitens sollte der Zugang für Strafverfolgungsbehörden einer richterlichen Überprüfung unterzogen werden und nicht durch die Bundespolizei genehmigt werden.
Drittens müssten die Betroffenen darüber informiert werden, wenn es bei einer Abfrage durch die Polizei einen Treffer in der Datenbank gibt. Und wenn Daten zwecks Rückführung an Drittstaaten weitergegeben werden, müsste dies in jedem Fall begründet werden, und es bräuchte eine Stellungnahme zum Datenschutz-Niveau des Drittstaates. Auch muss es Verfahren geben, die es Personen ermöglichen, Zugriff auf ihre Daten zu erhalten, nachdem sie den Schengenraum verlassen mussten. Eurodac-Daten werden teilweise jahrelang gespeichert und weiterverwendet.
All das ist aktuell aber nicht vorgesehen. Wir dürfen nicht vergessen, es geht hier auch um die Fingerabdrücke und Gesichtsbilder von Kindern ab sechs Jahren. Dass diese erfasst und von den Polizeien verwendet werden, müsste eigentlich ohnehin ausgeschlossen werden.
Hanna Stoll ist Rechtswissenschaftlerin an der Universität Zürich und Vorstandsmitglied von Solidarité sans frontières.
Dieses Interview erschien zuerst im Sosf-Bulletin Nr. 4/2024.